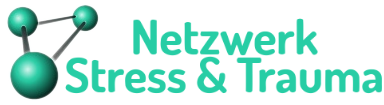Paradoxien und Ambivalenzen spielen auf unterschiedliche Weise in der Arbeit von Therapeuten und Coaches eine Rolle. In dieser Artikelserie wollen wir aufzeigen:
- Welche Bedeutungen haben diese beiden Phänomene?
- Wie sind sie unterscheidbar?
- Was kann das für die Arbeit von Coaches bedeuten?
- Was kann das für die Arbeit von Therapeuten bedeuten?
Im ersten Teil der Reihe geht es um die Klärung der beiden Phänomene:
Was ist mit Paradoxien gemeint?
Mit Paradoxien hat sich die Philosophie und insbesondere die Logik schon seit Ewigkeiten beschäftigt. Die früheste Überlieferung geht zurück auf Epimenides (5., 6. oder 7. Jahrhundert v.Chr.). Epimenides sagt: Alle Kreter sind Lügner. Da er selbst ein Kreter ist, führt seine Aussage in ein Paradox. Denn, wenn die Aussage wahr wäre, wäre er kein Lügner, wenn sie falsch wäre, dann wäre alle Kreter keine Lügner und damit auch nicht Epimenides.
Nach dieser Struktur sind logische Paradoxien gebaut: Die Selbstbezüglichkeit führt dazu, dass das Paradoxon entstehen kann. Das betrifft auch die Aussage: Dieser Satz ist falsch.
Die „Sei spontan“-Paradoxie
Eine andere Art von Paradoxie wird von Watzlawick[1] geschildert: die „Sei spontan!“-Paradoxie. Diese ist nach demselben Muster gebaut wie die Paradoxie des Lügners; denn wenn ich aufgrund der Aufforderung spontan zu sein versuche, kann ich ja nicht gleichzeitig spontan sein. Diese Aussage erzeugt Probleme für die psychische Verfassung des Adressaten und die entsprechende Kommunikationssequenz geht schief. D.h. wenn ein Vorgang, hier die Spontaneität, nur im Adressaten von sich aus entstehen kann, dann ruft die Aufforderung dazu einen unlösbaren Widerspruch hervor. Hier entsteht die Paradoxie aus der Art der kommunikativen Handlung ‚Aufforderung‘ und dem Inhalt der Aussage ‚spontan‘. Paradoxien dieser Art gibt es in unserer Sprache recht häufig. (s. ebd.)
Paradoxien auf der „Interpunktions“-Ebene
Die Entdeckung der Paradoxien innerhalb der Psychologie geht auf die Schizophrenie-Forschung[2] zurück und die dort dargelegte Wirksamkeit von double-binds. Diese können auf der oben beschriebenen Ebene von Kommunikationsereignissen entstehen oder durch entgegengesetzte Botschaften auf der Inhaltsebene und der Ebene, die Watzlawick als „Interpunktion“[3] bezeichnet, also der mimischen, gestischen und emotionalen Begleitung der Botschaft durch Tonfall, etc. Beispielsweise sagt eine Mutter zu ihrem Sohn: „Wir sind alle so traurig, dass Opa gestorben ist“ und lächelt dabei. D.h. der Sohn erhält zwei Botschaften, die er nicht in Übereinstimmung bringen kann: die Aussage ‚traurig‘ und das Lächeln der Mutter.
Welcher Botschaft soll er folgen? Wenn er das Lächeln ernst nimmt und z.B. sagt: „Er war schon eine Last“ kann die Mutter entgegnen: „Macht dir der Tod vom Opa gar nichts aus?“ und den Sohn so verwirrt zurücklassen. Wenn der Sohn stattdessen auf die erste Äußerung der Mutter antwortet: „ja, das ist wirklich schlimm“, und dabei ein trauriges Gesicht machen, kann die Mutter sagen: „Na, so schlimm ist es auch wieder nicht, stell dich nicht so an.“ So gerät der Sohn in ein unausweichliches Dilemma, dass alles, was er sagt, falsch sein könnte.
Was hat es mit Ambivalenzen[4] auf sich?
Ambivalenz ist so alt wie die Menschheit. Kulturell im Januskopf ausgedrückt: „Die gleichzeitige Einheit (der Gegensätze) der Zweiheit.“ (Fischer/Lüscher, 2014, S. 124)

„Unter der Bezeichnung »oszillieren« wird Ambivalenz von Anfang an und mittlerweile auch umgangssprachlich mit Vorstellungen und Erfahrungen verbunden, die als Hin- und Hergerissensein, Tauziehen, Pendeln, Balancieren, Zögern, Zaudern, Zweifeln, Schweben usw. beschrieben werden.“ (Lüscher/Fischer, 2014, S. 86)

Wenn sich jemand aus dem Hin- und Hergerissensein nicht lösen kann, sitzt er oder sie in der Falle. In jedem Fall bezieht sich Ambivalenz im Gegensatz zu Paradoxie auf innere Vorgänge. Wir schwanken zwischen zwei oder mehr Vorstellungen, können uns nicht entscheiden. Das kann eine starke innere Anspannung erzeugen, die uns nicht mehr zur Ruhe kommen lässt. Das kann sich zu einem großen Problem auswachsen bis hin zu völliger Entscheidungsunfähgikeit.
Ambivalenzen sind eigentlich der Normalfall
Systemisch würden wir sagen, Ambivalenzen gehören zum Leben, denn wann ist das Leben schon mal eindeutig? D.h. Ambivalenzen sind eigentlich der Normalfall, denn wann ist die Welt schon mal eindeutig. Das können wir ruhig im Wortsinn nehmen: Wann haben wir es mal mit Eindeutigkeiten zu tun? Natürlich gibt es die auch, doch meistens erleben wir eine vieldeutige Welt. Diese Vieldeutigkeit nimmt sogar noch zu durch die vielen Einflüsse, denen wir ausgesetzt sind. Eine Rolle spielt in einer multikulturellen Welt auch die kulturelle Differenz, die uns umgibt und die Eindeutigkeiten zunehmend erschwert.[5]
Bleib ambivalent!
Wesentlich für Ambivalenzen sind Polaritäten, zwischen denen wir hin und her schwingen. Und je stärker die Polarität ausgeprägt ist, um so stärker fühlt sich die innere Spannung darin an.
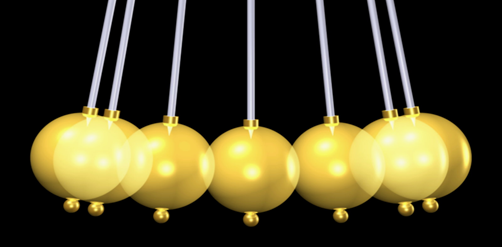
Um psychisch damit besser umgehen zu können, ist also eine Verringerung der Spannung in der Ambivalenz sinnvoll, damit das kreative Potential aus der Ambivalenz genutzt werden kann. Das ist der tiefere Sinn darin, wenn Systemiker, wie mein Lehrer Peter Müller-Egloff, sagen: „achte darauf, ambivalent zu bleiben“ in der Therapeuten- oder Beraterrolle.
[1] S. Watzklawick et al., (1974), S. 184 und Watzlawick (2009), S. 30 f. ; andere Aspekte der Theorie von Watzlawick habe ich in der Artikelreiche: „Wie mache ich mir das Leben schwer“, dargestellt.
[2] S. Bateson et al. ()
[3] Watzlawick et al (1974), S. 57 ff.
[4] Der Begriff wurde von Bleuler 1911 geprägt zur Bezeichnung von Verhaltens- und affektiven Mustern Schizophrener. Durch die Übernahme des Begriffs durch Freud und die Ausdehnung auf anthropologische Bereiche wurde der Begriff populär.
[5] Gerade diese Tendenzen geben den rechten politischen Strömungen in unseren Ländern Auftrieb, denn wir sehnen uns offenbar nach der verloren geglaubten Eindeutigkeit und dasmit Sicherheit, obwohl die, wenn diese in der Vergangenheit scheinbar da war, Unterschiede und Uneinduetigkeiten nur verdeckt hat.