Übernommene Traumata – Geteiltes Leid ist doppeltes Leid
„Was für eine tiefe und berührende Lebensgeschichte, verwoben in die Traumata der Mutter und der lange, beschwerliche und entlastende Weg der Heilung. Als langjähriger ROMPC Coach bin ich dankbar über die persönlichen Erfahrungen, die ich mit der Arbeitsweise und der dahinter liegenden Haltung machen durfte und darüber, mit dem Wissen im Coaching wirksam arbeiten zu können.“
Damit beginnt ein Kommentar von Martin Carstens auf die ersten zwei Artikel auf der Plattform LinkedIn.
Überwältigt sein vom Leid der Mutter
Die Geschichte, die uns heute so berührt, ist zugleich eine grausame Geschichte: Da wird eine junge Frau täglich zur Vergewaltigung abgeholt, ihr eigener Wille und ihr Schutz vernichtet, sie verliert den Vater, den Bruder und die Zwillingsschwester. Wie sollte sie das verkraften? Sie hätte eine nährende Umgebung gebraucht, aber in der Familie waren alle traumatisiert. Wenn uns Überwältigendes passiert („Überwältigendes bewältigen“, Beiträge zu einer Fachtagung der GBP), neigen wir dazu, es auszublenden, es ungeschehen zu machen.
Es ist ein normaler Abwehrvorgang, der dem Erhalt des Ich dient, hätte Freud gesagt. Im Angesicht dieses Überwältigenden ist es nicht möglich, ohne diese psychische Abwehr zu überleben. Das ist also eine reine Überlebensstrategie. Mit leben hat das nichts zu tun. Das kommt erst später, wenn wieder ein Stück Sicherheit spürbar ist. Für manche Trauma-Opfer kommt diese Sicherheit nie. Die Sicherheit könnte man daran erkennen, dass es bei aller Schwierigkeit möglich ist, über diese Ereignisse zu kommunizieren.
Verarbeitung von erlebtem Leid
Wir wissen heute, dass das Reden über solche Ereignisse der psychischen Verarbeitung hilft. Dazu brauche ich ein Gegenüber, das die emotionale Wucht hinter den Ereignissen aushält, denn sonst nützt es mir nichts. Ich habe immer wieder Trauma-Opfer erlebt, die emotionslos darüber sprechen konnten, was für sie aber nichts verändert hat. Erst wenn die zugehörigen Emotionen auftauchen dürfen, beginnt der Prozess der Verarbeitung und Einordnung in die eigene Lebensgeschichte. Das bleibende Problem ist es, dass durch die Vergegenwärtigung der Ereignisse die traumatischen Gefühle 1:1 wieder auftauchen, als würde es gerade jetzt passieren.
Wir blenden Erinnerungen an das Leid aus
Der Bereich in unserem Gehirn, der solche Erinnerungen speichert, kennt nur das unmittelbare Erleben, kennt keine Vergangenheit und es ist jedes Mal, wenn es auftaucht, (fast) so schrecklich, wie in der unmittelbaren Erfahrungssituation. Deshalb wollen und können diese Menschen sich ihren Erinnerungen nicht zuwenden, weil diese wieder die alte Angst entfalten, die sie glauben machte, nicht überleben zu können. (S.a. „Ist Härte und Unerbittlichkeit wieder angesagt?“)
Meine erste Traumapatientin erlebte jede Nacht wieder die traumatisierende Szene – in Schwarz-Weiß. Im Zuge der Arbeit, wurden die Träume farbiger, was ihr verständlicherweise Angst machte. Gleichzeitig war das ein Zeichen von Vertrauen, der Beginn einer gefühlten Sicherheit, die sie offenbar in der Beziehung zu mir erlebte. Und es war der Beginn eines Heilungsprozesses. Damals – in den 80er Jahren – verstand ich noch nicht so viel über Trauma, war aber schon damals in der Lage, mich einzufühlen, ohne in den Gefühlen meiner Klientin zu versinken. Das hat ihr offenbar genügend Sicherheit gegeben, um in diesen schwierigen Prozess einzusteigen.
Getragen in einer haltenden Beziehung
Dieses Gefühl von Sicherheit kann nicht aus mir selbst heraus entstehen, wenn ich durch ein traumatisches Ereignis so überwältigt bin und großes Leid erfahren habe. Ich brauche dazu eine tragende Beziehung. Heute nennen wir das das Beziehungsbedürfnis nach Sicherheit (siehe diese Veranstaltung des Syntraum-Instituts). Wenn ich das z.B. in meiner frühen Kindheit ausreichend erlebt habe, dann trage ich das ein Stück weit in mir und das kann mir in schwierigen Situationen weiterhelfen. Dennoch können auch solche Menschen Ereignissen ausgesetzt sein, die all diese Sicherheiten in Frage stellen.
Wenn das Leid und Sprachlosigkeit an Nachfolgende weiterlebt
Das wird geschildert von der Mutter in der Fallgeschichte, dass sie bis zu diesen traumatischen Ereignissen ein gutes Leben gehabt habe, also etwas Tragendes erlebt haben wird. Das muss so erschüttert worden sein, dass nur noch das nackte Überleben gerettet werden konnte bis ins hohe Alter und zu einem großen Teil bis in den Tod. In der Fallgeschichte wird sehr deutlich, wie sehr die Autorin unter der Last der Mutter gelitten hat.
Es ist ein Irrglaube, dass Schweigen die eigenen Kinder davor bewahrt, etwas von dem Schrecklichen mitzubekommen. Sie spüren, dass da etwas ist, ohne es benennen zu können. Wenn das Benennen nicht möglich ist, ist die psychische Verarbeitung mindestens stark eingeschränkt, wenn nicht unmöglich. Das ist einer der Wege, auf denen das Überwältigende sich in die Lebensgeschichten der Nachfolgenden „hineinwebt“.
Die Traumafäden im Lebensgewebe der Nachkommen
Diese Metapher macht deutlich, dass nicht das ganze Leben von den Ereignissen und dem Leid der Vorfahren betroffen sein muss, dass es sich aber in das Lebensgewebe hineingewoben hat und einen mehr oder weniger ausgeprägten Platz einnimmt. Hier könnten wir sagen: Das ist gut, wenn jemand nicht so viel spürt. Das ist einerseits richtig, andererseits kann das Nicht-spüren der Bewältigungsversuch des Überwältigenden sein, das sich der Sprache und Besprechbarkeit entzieht.
Übernahme des bewältigbaren Leids
Bei diesen schweren Ereignissen, wie sie sich insbesondere in Zusammenhang mit Kriegen abspielen, ist es für die Betroffenen nicht möglich, das Leid allein zu tragen, obwohl sie so tun, als könnte ihnen das gelingen. Es ist gut, wenn das auf mehrere Schultern verteilt werden kann, dass die jüngere Generation daran mittragen kann und auf gesellschaftlicher Ebene eine Verarbeitung erleichtert. Wir sehen es an unserer deutschen Geschichte, dass in den 2000er Jahren zunehmend mehr von den Traumatisierungen der Eltern- und Großelterngeneration ans Licht gekommen ist und auch die sekundär übernommenen Traumatisierungen dokumentiert wurden. (s. hierzu Bode, 2013 und 2015) (s.a. meinen Hintergrundartikel: Andersch-Sattler, 2020) WO?
Krieg und seine Opfer
Bei den von der Autorin geschilderten Ereignissen handelt es sich nicht um das Leid einer unmittelbar am Kriegsgeschehen beteiligten Person, sondern um ein ziviles Opfer, wie es heißt. Aber Kriege machen diesen Unterschied nicht, haben sie noch nie irgendwo auf der Welt gemacht. Die Erniedrigung des sog. „Feindes“ kann offenbar am besten in der Demütigung, Erniedrigung und Vergewaltigung von Frauen ausgedrückt werden.
Ich vermute, dass es noch nie einen Krieg gegeben hat, der gemäß den Bestimmungen der Genfer Konvention stattgefunden hat. Denn im Krieg werten sich die Werte um: Es gibt Leben, das weniger wert ist als meins und das meines Volkes. Deshalb bringe ich zu Recht die „anderen“ um. Jeder tote Soldat der „anderen“ ist ein guter Soldat. Im zivilen Leben brauchen wir, dass der Schutz jedweden Lebens hochgehalten wird. (S. hierzu einen Artikel aus der Süddeutschen Zeitung vom 22.05.22) So ist es auch in diesem Artikel beschrieben: Krieg zerstört nachhaltig unsere Kultur und unsere Werte, und es ist nicht einfach, diesen wieder zu ihrem Recht zu verhelfen.
Vom Leid in heutigen Kriegen
Wenn wir uns von den von der Autorin geschilderten Ereignissen betreffen lassen, dann müssen wir zugleich von dem betroffen sein, was gerade auf der Welt passiert, sowohl im bisher 3jährigen Krieg in der Ukraine als auch in Palästina. Das Leid, das in diesen Kriegen bisher schon erzeugt wurde, wird wieder lange brauchen, um verarbeitet zu werden. Viele sind gestorben, getötet worden, neben den Soldaten unendlich viele Zivilisten.
Ein ziviles Leben ist nicht mehr wert als ein soldatisches, aber die Menschen, die nicht an der Front sind, sind im üblichen Verständnis besonders schutzwürdig. Und wie ich oben bereits deutlich gemacht habe, halten sich Kriege nicht an die Genfer Konvention. So können wir eigentlich nur den Krieg als solchen ächten und Bemühungen für Frieden wesentlich verstärken, auch wenn verschiedene Akteure am Frieden nicht interessiert zu sein scheinen, sondern sogar ihre Vorteile wittern in der Fortführung der kriegerischen Handlungen, egal wie viel Leid dadurch erzeugt wird.
Wehrtüchtigkeit und/oder Pazifismus?
Heribert Prantl hat im letzten Jahr ein Buch geschrieben mit dem Titel „Den Frieden gewinnen. Die Gewalt verlernen“, in dem er ein leidenschaftliches Plädoyer für den Frieden vor uns ausbreitet und ausdrücklich gegen die neue „Kriegsertüchtigung“ argumentiert, die zur Martialisierung unserer Gesellschaft beiträgt und dabei nicht in erster Linie den Frieden im Blick hat.
In der alten Friedensbewegung galt die Aussage: „Wer Waffen hat, benutzt sie auch.“ Da ist etwas dran, denn das sehen wir an den Amokläufen in den USA, wo jede/r schnell an eine Waffe kommen kann. Dennoch sind die Täter laut einer Analyse der Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle Seite 4 zu 95% männlich.
Ethik und Moral in Kriegen?
Kriege können vermutlich nicht anders geführt werden, als Ethik und Moral in Kriegen zu ignorieren. Gerade in einem Dauerkrieg wie in der Ukraine oder wie in Palästina, wo schon seit langem die Palästinenser für Terroristen gehalten werden, obwohl inzwischen große Teile der Bevölkerung im Gaza-Streifen gegen die Hamas auf die Straße gehen. Und trotzdem geht das Töten durch die israelische Armee weiter. Denn sie zurecht davon aus, dass sich die Mitglieder der Hamas in zivilen Umgebungen aufhalten, so dass Flächenbombardements im Bewusstsein stattfinden, dass viele Zivilisten sogenannte Kollateralschäden darstellen werden.
All das muss eigentlich dazu führen, dass wir den Krieg ächten, wenn wir uns als Gesellschaften nicht zumuten wollen, was an Leid sich in den Einzelschicksalen über Generationen in der Geschichte der Autorin zeigt. Wir können diese Einzelschicksale mit einem hohen Multiplikator multiplizieren. Wie hoch, das weiß keiner, aber in unserer Gesellschaft werden vermutlich noch 30% von den Folgen des Zweiten Weltkriegs betroffen sein. Diese Schätzung nehme ich vor, weil sich in den Familienaufstellungen, die wir durchführen, immer wieder solche Verbindungen und Verknüpfungen zeigen, die Nachgeborenen als sich als belastend im heutigen Leben erleben.
Was können wir tun?
Das heißt nicht zwangsläufig, dass wir uns nicht als wehrhaft zeigen sollen, um skrupellosen Machthabern entgegenzutreten. Aber mit welcher Ethik und mit welcher Moral können wir das tun? Darauf kann ich im Moment selbst keine Antwort geben. Darüber bräuchten wir aber einen gesellschaftlichen Diskurs. Die Lösung kann nicht sein, dass wir uns diesen skrupellosen Machthabern quasi nackt gegenüberstellen, während sie bis zu den Zähnen bewaffnet sind und eben keine moralischen Skrupel haben, wehrlose Menschen zu vernichten.
- Aber kann es die Lösung sein, selbst zum Angreifer zu werden?
- Wenn ja, welche moralisch-ethischen Grenzen brauchen wir auch für diesen Fall?
Fragen über Fragen. Manchmal sind die Fragen wichtiger als die Antworten!
Vielleicht habt ihr Antworten, liebe Leser!?!
Literatur:
- Bode, Sabine, Kriegsenkel, Stuttgart (Klett-Cotta) 2013
- Bode, Sabine, Die vergessene Generation, Stuttgart (Klett-Cotta) 2015
- Amoktaten – Forschungsüberblick unter besonderer Beachtung jugendlicher Täter im schulischen Kontext, Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle, Analysen Nr. 3/2007 hg. v. Landeskriminalamt NRW
- Prantl, Heribert, Den Frieden gewinnen. Die Gewalt verlernen, München (Heyne) 2024
- Andersch-Sattler, Heinz-Günter, Eigene und übernommene Traumatisierungen, in: Zeitschrift Psychosozial, Jahrgang 43, Nr. 161, 2020, S. 74 ff.
- Überwältigendes bewältigen. Körperpsychotherapeutische Methoden in der Traumatherapie, Beiträge der 20. Fachtagung der Gesellschaft für Biodynamische Psychologie, 2018
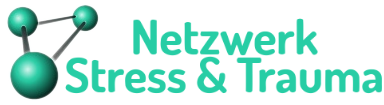




Schreibe einen Kommentar