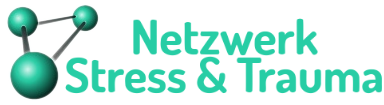Philosophie des Glücks – Glück haben oder glücklich sein?
Glück – ein Wort, das wir alle verwenden und das zugleich so vielschichtig ist.
Im Alltag sprechen wir davon, „Glück gehabt“ zu haben – etwa, wenn ein Unfall knapp vermieden oder die Bahn gerade noch erreicht wurde. In der Philosophie des Glücks und in der Psychologie hingegen bedeutet Glück weit mehr als Zufall: Es geht um die Frage nach einem guten Leben, nach Sinn und nach innerer Haltung. Glück fällt nicht vom Himmel, sondern ist eine bewusste Aufgabe und Möglichkeit, die wir aktiv gestalten können – ein Kontrapunkt zu Stress und Trauma.
Glück haben vs. glücklich sein – eine psychologische Perspektive
Die Alltagssprache unterscheidet kaum zwischen „Glück haben“ und „glücklich sein“. Doch inhaltlich ist diese Differenz entscheidend:
Glück haben:
Günstige Umstände, die unser Leben erleichtern – ein Lottogewinn, eine zufällige Begegnung, ein unverhoffter Erfolg.
Glücklich sein:
Ein Zustand innerer Zufriedenheit und Erfüllung, der unabhängig von Zufall oder äußeren Ereignissen besteht.
Gerade im Kontext von Stress und Trauma wird sichtbar, wie bedeutsam dieser Unterschied ist. Belastungen können verhindern, Glücksmomente wahrzunehmen – und dennoch ist Glück möglich, wenn wir es bewusst einüben, z. B. durch Dankbarkeit als Ressource. Zahlreiche Studien belegen, dass Dankbarkeit ein Schlüssel zu mehr Wohlbefinden ist.
Beispiel aus der Praxis:
Anna, 42, meldet sich nach einem Burnout. Sie kann sich nicht mehr erholen, alles ist anstrengend, der Schlaf von langen Grübelphasen unterbrochen, sie empfindet keine Freude mehr, fühlt sich nur noch gehetzt und hat Angst, alles falsch zu machen.
Im ersten Schritt ist es für sie wichtig, die akuten Stressoren zu identifizieren und deren Auswirkungen zu minimieren. Hierzu setze ich Entkoppelungstechniken (ROMPC) ein, die auf die akute Belastungssituation wirken.
Im zweiten Schritt erkunden wir, wie sie es gelernt hat, sich selber schnell schuldig zu fühlen. Der hier wirksame Hintergrund geht zurück auf ihre Herkunftsfamilie und die von beiden Eltern praktizierten Schuldzuweisungen, die Anna irgendwann als selbstverständlich hingenommen hat, als gehöre das zu ihr und ihrer Persönlichkeit.
Indem Anna diese Muster erkennen und auf den familiären Kontext zurückführen kann, ist sie in der Lage die zugehörigen Verletzungen wahr- und ernst zu nehmen. Sie gibt sich Zeit für die Heilung der alten Verletzungen und steigert so ihre Bereitschaft, sich angenehmen Dingen des Lebens zuzuwenden: Sie beginnt mit Übungen und Routinen (s.u.), die ihr einen Zugang zu mehr Glück in ihrem Leben eröffnen.
Sie erkennt: Glück ist nicht nur Zufall, sondern kann durch bewusste Routinen entstehen.[1]
Glück in der Philosophie – von Aristoteles bis Viktor Frankl
Seit der Antike haben Philosophen über das Glück nachgedacht.
- Für Aristoteles war Glück – die ‚Eudaimonia‘ – das höchste Ziel menschlichen Handelns. Es entsteht nicht durch Zufall, sondern durch ein tugendhaftes Leben.
- Epikur sah Glück hingegen in der Reduktion von Bedürfnissen und der Pflege von Freundschaft.
- Die Stoa betonte die innere Haltung: Glück ist, wenn wir unabhängig vom Zufall und den Wechselfällen des Lebens gelassen bleiben.
- Buddha wiederum stellte das Überwinden von Leid in den Mittelpunkt – Glück als Freiheit von Anhaftung.
- In der Moderne sprach Viktor Frankl davon, dass Glück nicht direkt angestrebt werden kann, sondern als Nebenprodukt eines sinnvollen Lebens entsteht.
- Martha Nussbaum entwickelt mit ihrem Fähigkeitsansatz die Idee, dass Glück daraus resultiert, menschliche Grundfähigkeiten zu entfalten.
- Hannah Arendt schließlich verband Glück mit Freiheit und dem aktiven Handeln in Gemeinschaft.
- Ludwig Marcuse fasste viele dieser Strömungen zusammen und beschrieb Glück als zentrale Kategorie, die Philosophie und Lebenspraxis verbindet.
Die Metapher der Inseln des Glücks
Ein besonders anschauliches Bild ist die Metapher von den ‚Inseln des Glücks‘.
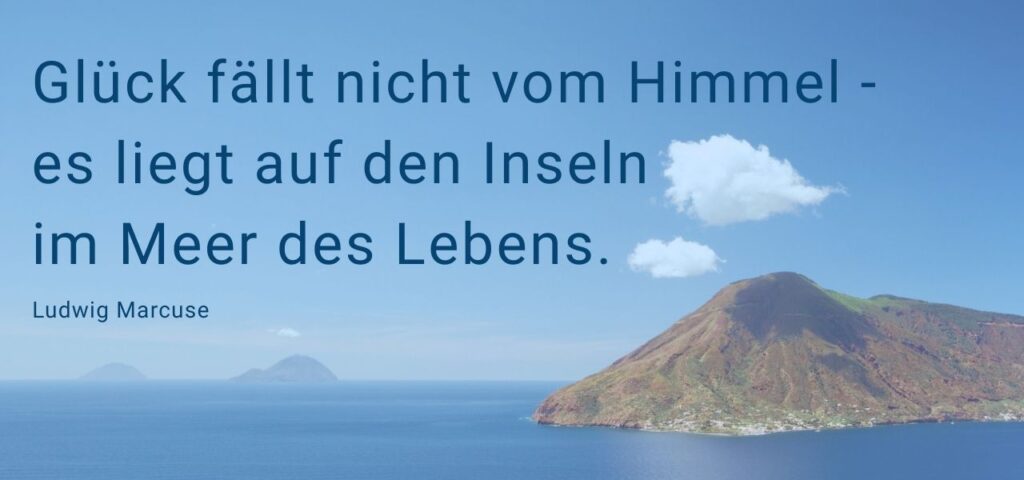
Sie verdeutlicht: Glück ist nicht das Festland, das uns dauerhaft trägt. Vielmehr sind es einzelne Inseln, die im Meer des Lebens auftauchen. Zwischen ihnen liegen oft Phasen von Alltag, Anstrengung, ja auch von Schmerz. Doch gerade diese Inseln sind es, die Orientierung und Hoffnung geben. Wer sie erkennt, kann sie bewusst ansteuern – auch wenn das Meer manchmal stürmisch ist.
Wer sich mit Sinn, Freiheit oder Gemeinschaft beschäftigt, erkennt schnell: Glück ist eng mit Resilienz und der Fähigkeit verbunden, auch in schwierigen Zeiten Orientierung zu finden. (s. Das Bedürfnis nach Sicherheit in einer unsicheren Welt). Frankls Ansatz zeigt zudem: Glück ist ein Nebenprodukt eines sinnvollen Lebens (s. Viktor Frankl Institut Wien).
Glück in der Psychologie – Wohlbefinden und Resilienz
In der Psychologie wird Glück oft mit Wohlbefinden und Resilienz verbunden.
Es geht um die Fähigkeit, positive Emotionen wahrzunehmen, soziale Beziehungen zu gestalten und Sinn zu erleben. Für Menschen mit traumatischen Erfahrungen bedeutet das:
Glücksmomente bewusst wahrzunehmen, kann Teil des Heilungsprozesses sein. Kleine Schritte – etwa Momente der Dankbarkeit, das Spüren des Körpers, oder eine Begegnung mit einem Menschen – werden zu Bausteinen für ein neues Fundament. Übungen sind dabei hilfreich, die Gedankenstress auflösen oder Blockaden durch Entkoppelungstechniken lösen z.B. mit ROMPC. Die American Psychological Association bietet hierzu zahlreiche wissenschaftlich fundierte Artikel.
Übungen für mehr Glück im Alltag
Diese einfachen Routinen helfen, Glück aktiv zu fördern:
1. Glücksmomente sammeln
Notieren Sie am Abend drei Dinge, die Freude bereitet haben.
2. Philosophische Reflexion
Wählen Sie ein Zitat (z. B. Aristoteles: „Glück ist das Ziel allen Handelns“) und fragen Sie: Wo erkenne ich das in meinem Leben?
3. Körperliche Glücksgeste
Stellen Sie sich aufrecht hin, lächeln Sie, atmen Sie tief – für zwei Minuten.
Spüren Sie, wie Haltung und Stimmung sich verändern.
Ein anschauliches Beispiel, wie solche Methoden bei psychosomatischen Beschwerden wirken können, findet sich im Beitrag Migräne – Lösung bei Stress und Trauma. Diese Ansätze entsprechen den Erkenntnissen der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie, die seit Jahren die Forschung zu Wohlbefinden und Resilienz im deutschsprachigen Raum verbreitet.
Fazit: Glück als Haltung und Entscheidung
Glück fällt nicht vom Himmel.
Es ist nicht nur Geschenk des Zufalls, sondern auch Ergebnis einer inneren Haltung und bewussten Suche.
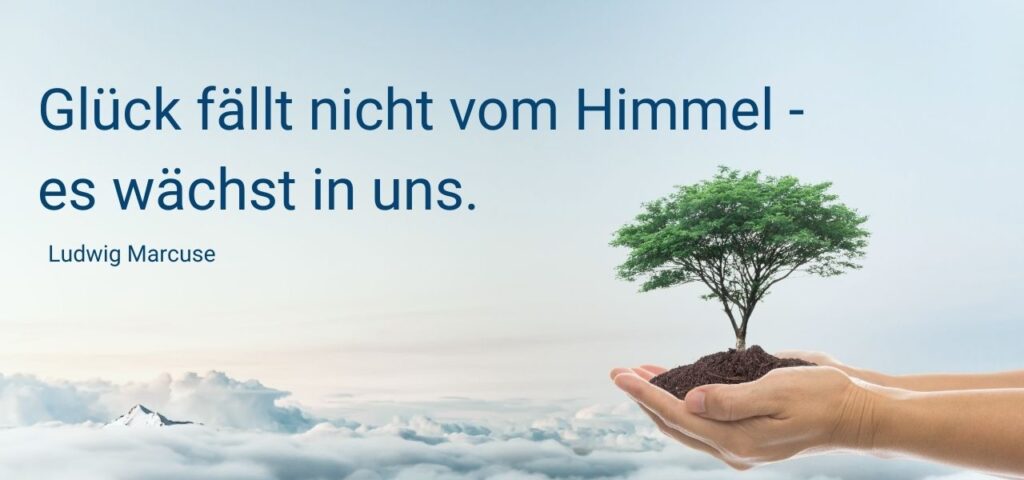
Philosophie und Psychologie laden ein, Glück als „Inseln im Meer des Lebens“ zu verstehen. Wer diese Inseln erkennt, würdigt und pflegt, erlebt selbst in Zeiten von Stress und Zweifel Lebensfreude und Sinn – und kann lernen, in Freude alt zu werden.
👉 Möchten Sie lernen, wie Dankbarkeit und Glück in Ihrem Alltag wachsen können?
Besuchen Sie unsere Seminare und Workshops zur Positiven Psychologie und Traumatherapie: [www.syntraum.de] (https://www.syntraum.de)
Literatur
- Aristoteles: Nikomachische Ethik. Ditzingen (Reclam) 2017
- Epikur: Über das Glück. Zürich (Diogenes) 2011
- Seneca: Vom glückseligen Leben und andere Schriften. Ditzingen (Reclam) 1986
- Buddha: Die vier edlen Wahrheiten. Texte des ursprünglichen Buddhismus. Ditzingen (Reclam) 1998
- Frankl, Viktor: … trotzdem Ja zum Leben sagen. München (Penguin Verlag) 2018
- Nussbaum, Martha C.: Creating Capabilities: The Human Development Approach. Harvard University Press, 2011
- Arendt, Hanna: Vita activa oder Vom tätigen Leben. München, Zürich (Piper) 2002
- Marcuse, Ludwig: Philosophie des Glücks. Zürich (Diogenes) 1996
- Metapher ‚Inseln des Glücks‘: Quelle bei Ludwig Marcuse, Philosophie des Glücks.
[1] Weitere Fallbeispiele:
Michael, 55, mit traumatischen Kindheitserfahrungen, entdeckt durch kleine Übungen, dass Glücksmomente trotz Schmerz möglich sind.
Sofia, 29, Philosophin, findet bei Epikur die Einsicht: Glück liegt im Einfachen – Ruhe, Freundschaft, Gegenwart.Einleitung